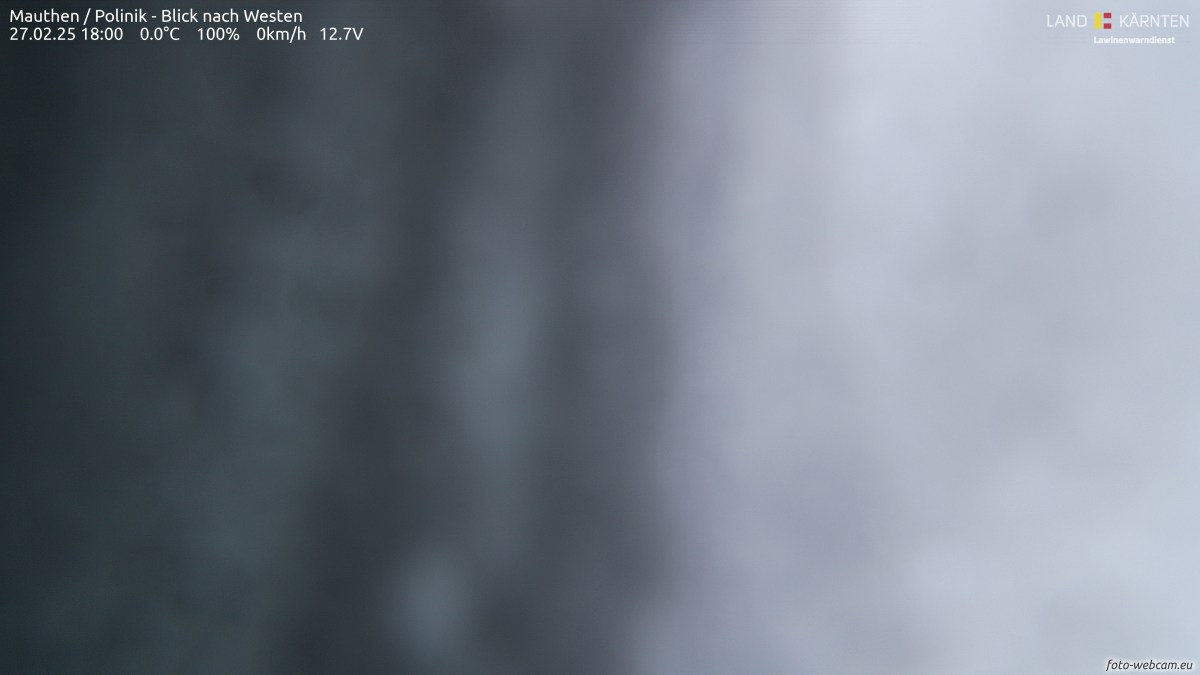Aktuell
BÜROZEITEN im AV Büro jeden
Donnerstag von 18.00 – 19.00 Uhr
https://www.oeav-obergailtal.at/blog/
Einladung zu geführten Touren unter NEWS
Veranstaltungen der Jugend unter JUGEND
Einladung zu anderen Veranstaltungen der Sektion
nach unten scrollen
Ausbildung
Neuer Termin!

Anmeldung
Einladung zur Mitgliederversammlung
Anmeldung zur Mitliederversammlung
Hier sind unsere letzten Beiträge
- AAA Jugendtreffen
 in Kärnten, Friaul und Slowenien Vor 35 Jahren hatte Sepp Lederer aus Mauthen die Idee, für die Jugend ein grenzüberschreitendes Treffen für die Jugend zu veranstalten und fand in Graziano Romanin aus Forni Avoltri (Friaul),… Weiterlesen »AAA Jugendtreffen
in Kärnten, Friaul und Slowenien Vor 35 Jahren hatte Sepp Lederer aus Mauthen die Idee, für die Jugend ein grenzüberschreitendes Treffen für die Jugend zu veranstalten und fand in Graziano Romanin aus Forni Avoltri (Friaul),… Weiterlesen »AAA Jugendtreffen - Eislaufen
 ein beliebter Freiluftsport Bei den ersten Minusgraden Ende November beginnen wir mit einer äußerst aufwändigen Aufbereitung von Natureis im ÖAV-Freizeitpark, bis schließlich unsere Eislaufarena in den Monaten Dezember bis Mitte Februar täglicher Anziehungspunkt für junge… Weiterlesen »Eislaufen
ein beliebter Freiluftsport Bei den ersten Minusgraden Ende November beginnen wir mit einer äußerst aufwändigen Aufbereitung von Natureis im ÖAV-Freizeitpark, bis schließlich unsere Eislaufarena in den Monaten Dezember bis Mitte Februar täglicher Anziehungspunkt für junge… Weiterlesen »Eislaufen - Eishockey
 ein rasanter Sport Unsere Eislaufarena ist in den Monaten Dezember bis Februar täglicher Anziehungspunkt für Eislaufbegeisterte und eine wichtige Infrastruktur im Bergsteigerdorf Mauthen. Es werden auch Eislaufkurse angeboten! Der Aufwand für die tägliche Pflege der… Weiterlesen »Eishockey
ein rasanter Sport Unsere Eislaufarena ist in den Monaten Dezember bis Februar täglicher Anziehungspunkt für Eislaufbegeisterte und eine wichtige Infrastruktur im Bergsteigerdorf Mauthen. Es werden auch Eislaufkurse angeboten! Der Aufwand für die tägliche Pflege der… Weiterlesen »Eishockey - Fotos Alpin Triathlon

- Alpin Triathlon
 Klettern & Mountainbiken & Geländelauf Die alljährlich wohl härteste Veranstaltung ist dieser Triathlon, ausgetragen im ÖAV-Zentrum und Umgebung. Alle Teilnehmer*innen werden voll gefordert und geben ihr Letztes, bis sie endlich im Ziel sind. Kommentare bitte… Weiterlesen »Alpin Triathlon
Klettern & Mountainbiken & Geländelauf Die alljährlich wohl härteste Veranstaltung ist dieser Triathlon, ausgetragen im ÖAV-Zentrum und Umgebung. Alle Teilnehmer*innen werden voll gefordert und geben ihr Letztes, bis sie endlich im Ziel sind. Kommentare bitte… Weiterlesen »Alpin Triathlon - Regionale Kunst
 Eine vielfältige Auswahl Nach unten scrollen und Künstler oder Kunst auswählen! Prof. Adalbert Kunze Hans Sellenati Prof. Franz Kaplenig Prof. Raimund Kalcher Prof. Peter Brandstätter Johann Weichard Valvasor Aegid Sonnleithner Marta Elisabet Fossel Kommentare bitte… Weiterlesen »Regionale Kunst
Eine vielfältige Auswahl Nach unten scrollen und Künstler oder Kunst auswählen! Prof. Adalbert Kunze Hans Sellenati Prof. Franz Kaplenig Prof. Raimund Kalcher Prof. Peter Brandstätter Johann Weichard Valvasor Aegid Sonnleithner Marta Elisabet Fossel Kommentare bitte… Weiterlesen »Regionale Kunst
Zum gesamten BLOG

Blickpunkt Magazin
Das Magazin für alle Sektionsmitglieder mit Berichten und Blickpunkten zu den Tätigkeiten im und um den Alpenverein Obergailtal-Lesachtal.